|
| Geschichte
der Sternwarte |
  |
| Das
jetzige Sternwartengebäude ist nicht die erste Sternwarte Würzburgs.
Diese war im Turm der Neubaukirche eingerichtet und bis in die 1960er
Jahre in Betrieb. Daran erinnert eine Gedenktafel an der linken
Außenwand des Turms. |
|
 |
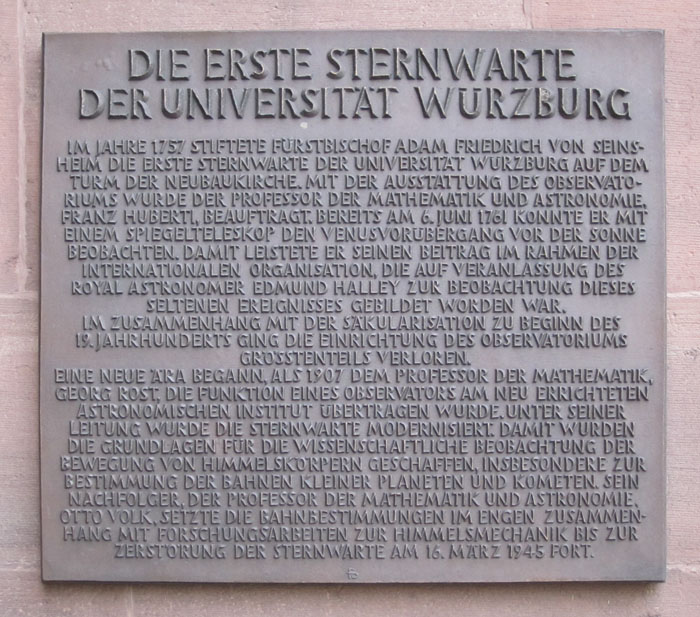
Aufnahmen: J. Laufer
|
|
Zwischenzeitlich hatte die Universität Würzburg eine neue Sternwarte bekommen. Nachdem der Berliner Hotelbesitzer Curt Elschner
50000 Rentenmark (heutige Kaufkraft 195000 €) zum Bau einer neuen Sternwarte gestiftet hatte, konnte
Prof. Georg Rost 1927 auf dem Westflügel der Neuen Universität am
Sanderring die "Neue Sternwarte" errichten, die mit einer drehbaren
Kuppel, einem 20-cm-Zeiss-Refraktor und den modernsten Photoapparaten
ausgestattet war. Damit wurde es möglich, die Würzburger Sternwarte an
der Beobachtung der Kleinen Planeten und Kometen zu beteiligen. Elschner wurde die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät verliehen.

(Aus:
P. Baumgart(Hrsg.), Die Univerität Würzburg in den Krisen der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts, Quellen und Forschungen zur Geschichte des
Bistums und Hochstifts Würzburg, Würzburg /Schöningh), 100-124)
|
 |
|
Würzburg,
Neue Universität
am Sanderring
1896 eingeweiht als
"Neues Kollegienhaus"
1927 Errichtung der Sternwarte auf dem
Westflügel. Internationale Sternwartennummer "028"
16. März 1945
Zerstörung durch alliierten Bombenangriff
Mit
freundlicher Genehmigung von:
Daniel
Seidel, Fa. Ansichtskartenpool |
Am
16. März 1945 wurde
Würzburg von alliierten Streitkräften bombardiert. Dabei wurde
auch die Neue Universität am Sanderring getroffen und schwer beschädigt.
Dabei blieb zwar offenbar die Sternwarten- kuppel als Ruine erhalten,
wurde aber zusammen mit den zerstörten Instrumenten abgetragen
und durch ein Notdach ersetzt. Luftaufnahmen, auf denen sich der Zustand
vor und nach der Bombardierung erkennen lässt, findet man hier, hier und hier.
|
1930 wurde Prof. Otto Volk auf das
Extraordinariat berufen. Man hatte ihn von der Universität Kaunas in
Litauen abgeworben, wo er ein Astronomisches Institut errichtete.
In
der Nachkriegszeit wurde wieder in der notdürftig hergerichteten
Sternwarte auf dem Neubauturm beobachtet, denn als Interimslösung bis
zur Fertigstellung der "Stadtranduniversität" 1974 war das Astronomische
Institut an den Mainkai gezogen (Büttnerstraße 72) - und Übungen für
Studenten wurden auch auf der
sogenannten "Balthasar-Neumann-Kanzel" in der Franziskanergasse
abgehalten.
Prof. Volk setzte sich für einen eigenen Lehrstuhl für Astronomie an der
Universität Würzburg ein. Damals lief die Astronomie noch als
Teilbereich der Mathematik, denn Positions- und Bahnbestimmung von
Himmelskörpern, was damals fast ausschließlich betrieben wurde, sind
vorwiegend mathematische Aufgaben. Heute ist die Astrophysik das
Hauptaufgabengebiet. Prof. Volk setzte sich daher schon früh für den Bau
einer neuen Sternwarte außerhalb der Stadt ein. Zwar hatte die
Universität kein Geld, dafür sprang die Stadt Würzburg in die Bresche
und bot als Standort den Pausenhof der neuen Schule
auf der Keesburg (Kepler-Schule) an. 1963 war der erste Spatenstich, am 5.5.1966 die
feierliche Einweihung der neuen Sternwarte.
|
|

Aufnahme: J. Laufer
|
 |
|


Aufnahmen von Planung und Bau der Sternwarte im Hof des Neubaus der Johannes-Kepler-Schule im Stadtteil Keesburg.
Aufnahmen: Erwin Schmollinger
 Oben: Die Erstausstattung der Sternwarte Oben: Die Erstausstattung der Sternwarte |

|
|
Die Erstausstattung der Sternwarte bestand aus mehreren Instrumenten. Bei der Übernahme des Instituts durch Prof. Hans Haffner im April 1967 fand er folgende Ausstattung vor: eine Montierung der Firma VEB Zeiss in Jena/DDR, auf der vier Instrumente angebracht waren, in erster Linie das AS 130/1950 (zweilinsiges Objektiv
mit 13 cm Linsendurchmesser und 1,95 m Brennweite), ebenfalls von
Zeiss, daneben ein Väisälä Schmidt-Spiegel 200/250/573 mm und zwei
vierlinsige Astrokameras, eine mit
120 mm Öffnung und 600 mm Brennweite, die andere mit 160 mm Öffnung und
540 mm Brennweite. Diese Geräte sind auf der nebenstehenden Aufnahme zu
sehen.
Mit diesen Instrumenten wurde von den Professoren Volk und Haffner noch längere Zeit Aufnahmen von Planetoiden
gemacht, um deren Position und Bahn zu
bestimmen. Erst in neuerer Zeit wurde das wieder als wichtig erkannt, um
in Richtung Erde fliegende Objekte (NEOs) frühzeitig zu orten und gegebenenfalls Abwehrmaßnahmen ergreifen zu können.
Vorhanden waren zahlreiche Zubehörteile wie
Doppelstern-Mikrometer, Protuberanzen-Spektroskop, photographische
Kameras, zwei Quarzuhren (Mittlere Zeit und Sternzeit), wechselseitig
umschaltbar zur Steuerung des Fernrohrantriebs, ein Ascania
Iris-Photometer, ein Leitz Koordinaten-Meßapparat (zwei Koordinaten je
20 cm Schraubenlänge) sowie mehrere anedere Meßgeräte. 1968 wurde die
Werkstatt im Untergeschoß eingerichtet, dafür wurden die dort
aufgestellten Meßgeräte ins Institut in der Büttnerstraße gebracht. In
der Dunkelkammer wurden vorwiegend Kopien des "Atlas of the Southern Milky Way" hergestellt.

Das Foto zeigt sehr schön, dass der ursprüngliche Plan exakt umgesetzt wurde:
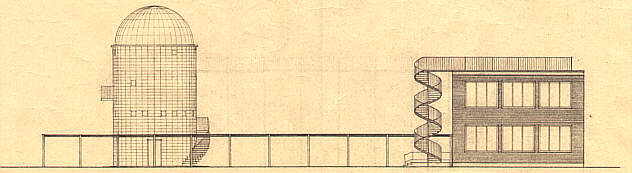

Aufnahme: Erwin Schmollinger
|
|
Durch
eine Spende der Oberpostdirektion Nürnberg erhielt die Sternwarte zwei
3-m-Aluminium-Parabolspiegel, die am 10. Juli 1970 von ihrem
Aufstellungsort im Spessart durch Hubschrauber der Bundeswehr zur
Siebolds-höhe geflogen und dort auf der Terrasse der Sternwarte auf der
Johannes-Kepler-Schule aufgestellt wurden. Für die Empfangsanlage der
Radiostation wurde eine gebrauchte Aluminiumhütte erworben. Mit einem
von der Bundespost überlassenen Richtfunk-empfänger, der für den
speziellen Einsatzzweck umgebaut wurde, stellte man Empfangsversuche bei
2,5 GHz an. Mit der zweiten Schüssel zusammen sollte ein Interferometer
entstehen, was aber nie realisiert wurde. |
1970 wurde eine TV-Kamera und ein Fernseher
für den Zeiss-Refraktor beschafft, die bei
den Führungen benutzt wurden. Der Assistent richtete das Teleskop mit
angebrachter Kamera auf den Mond. Im Vortragsraum konnten so alle
Besucher den Mond am Fernsehapparat gleichzeitig sehen. 1976 erhielt die
Zeiss-Montierung regulierbare elektrische Feinantriebe für die Bewegung
in Stunden und Deklination, wodurch die Verwendbarkeit des Teleskops
sehr verbessert wurde.
|
1978 wurde dann für
Ausbildung und öffentliche Führungen auf der vorhandenen Montierung ein Celestron C 14 Schmidt-Cassegrain-Teleskop
mit einer Öffnung von 354 mm und einer Brennweite von 4 m installiert, das aus Berufungsmitteln von Prof. Franz-Ludwig Deubner, dem Nachfolger des 1977 verstorbenen Prof. Haffner,
beschafft wurde. Im Schnitt wurden für die Öffentlichkeit etwa drei
Führungen monatlich angeboten, die aber nur bei klarem Himmel
stattfanden. Dazu gab es je nach Nachfrage ähnlich viele Termine für
Gruppen.
In den 1980er Jahren
wurden einige der dann nicht mehr benötigten Geräte verkauft bzw.
verschenkt.
Die Sternwarte wurde vom Astronomischen Institut der Universität 35
Jahre lang bis 2001 betrieben und am 25. November 2001 in die Hände
unseres seit Mitte 1985 bestehenden Vereins "Volkssternwarte Würzburg
e.V." übergeben.
|
|
 |
Das C14 blieb neben dem
Zeiss-Refraktor das Hauptinstrument bis 2016. Zuerst waren beide Geräte
einander gegenüber angebracht, was jedoch zu gravierenden Stabilitätsproblemen
führte. Anfang
der 2000er Jahre wurden daher beide
Teleskope auf einer Seite montiert.
 |
|
 |
Nach fortgesetzten Vandalismusanschlägen spendierte die Stadt der Sternwarte Anfang 2007 neue Fenster und Türen.
Im Juni 2007 stürzte ein Holzteil vom Kuppeldach in den Pausenhof der Schule. Die Stadt handelte schnell und ließ die Kuppel durch eine Fachfirma reparieren.
Nach einem Wasserschaden im April 2009 durch ein gebrochenes Fallrohr wurde die Sternwarte bis 2010 von der Stadt und mehreren Vereinsmitgliedern aufwendig saniert. |
|
 |
|
|
Aufnahme oben: G. Skalka (Keplerschule)
|
Während unsere anfänglichen Befürchtungen ungefähr so aussahen:

stellte sich die fertige Sternwarte - nach Sanierungsarbeiten an der
Außentreppe und einem kompletten Neuanstrich - im Frühjahr 2015 dann so
dar:
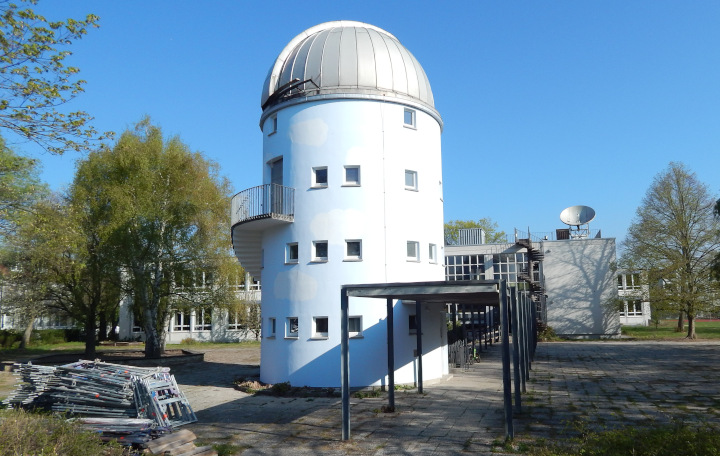
Wir setzen die schon seit der Eröffnung der Sternwarte 1966 angebotenen
Führungen und Himmelsbeobachtungen für die Öffentlichkeit fort und haben
dazu 2016 das gesamte Instrumentarium modernisiert.
Nach der Renovierung der Sternwarte zum 25-jährigen Bestehen des Vereins
Volkssternwarte Würzburg e.V. im Jahr 2010 konzentrierten wir uns auf
eine komplette Erneuerung des inzwischen in die Jahre gekommenen
Geräteinventars. Nach dem großen "Update" konnten die neuen Teleskope in
der Kuppel Mitte 2016 in Betrieb genommen wurde.
|
Uns
stehen jetzt drei moderne Teleskope für verschiedene Einsatzbereiche
zur Verfügung. Hauptinstrument ist ein Spiegelteleskop der Firma Meade
mit 406 mm Öffnung und einer Brennweite von 3,25 Metern. Damit lassen sich
sowohl feinste Einzelheiten auf Planeten als auch schwache ferne
Himmelsobjekte wie zum Beispiel Spiralnebel beobachten.
Dazu kommt ein
von unserem Vereinsmitglied Ralf Mündlein geplantes, konstruiertes und
selbst gebautes Linsenteleskop mit 160 mm Linsendurchmesser und 1,6 m
Brennweite. Es ist besonders für die Sonnen- und Mondbeobachtung
geeignet, aber auch bei unruhiger Luft besser als der Spiegel für die
Planetenbeobachtung geeignet, da es nicht so empfindlich auf Turbulenzen
reagiert.
Vervollständigt wird das Set durch ein weiteres kleines
Linsenfernrohr mit zwar nur 10 cm Öffnung und 90 cm Brennweite, das aber von der
Optik her ideal zu unserem Sonnenfilter passt und dadurch die Beobachtung
von Sonneneruptionen erlaubt.
|
|

|
|
